anderen Konservie-
rungsmitteln


anderen Konservie-
rungsmitteln

die Verantwortung für die Weinerzeugung im elterlichen Betrieb.
Dort führte ich sofort Innovationen ein:
- 1959 - Wir filtern den Most vor der Gärung.
So entstehen wunderbar reine Weine mit viel Restsüße, die damals sehr beliebt sind. - 1960 - Von jedem Wein veröffentlichen wir Analysen über den Gehalt an Alkohol, Säure und Restsüße.
Erst 60 Jahre später wird das zum Standard in der Weinwirtschaft. - 1982 - Wir erzeugen den ersten Wein ohne Sulfitzusatz
- 1984 - Mit 20 Medaillen bei dem Concours International des Vins Braislava-Nitra werden
wir als weltweit bester Weinerzeuger ausgezeichnet.
Der Verkostungswettbewerb mit internationaler Jury prämiert die besten Produkte aus aller Welt. - 1994 - Alle Weine unserer Kellerei werden ohne Sulfitzusatz produziert
- 2000 - Wir erzeugen unseren ersten Wein aus vitalen Reben
- 2001 - Direkt nach der Ernte trennen wir die Beeren von den Stengeln, die sonst
einen bitteren Geschmack an den Wein abgeben würden
Wir keltern nur die Beeren. - 2007 - Alle unsere Weine sind vegan, ihr Sulfitgehalt liegt immer unter 10 Milligramm,
die Werte für Histamin liegen unter der Nachweisgrenze von 0,25 mg / L
- 2020 - Den größten Teil unserer Weine keltern wir aus den Beeren vitaler Reben
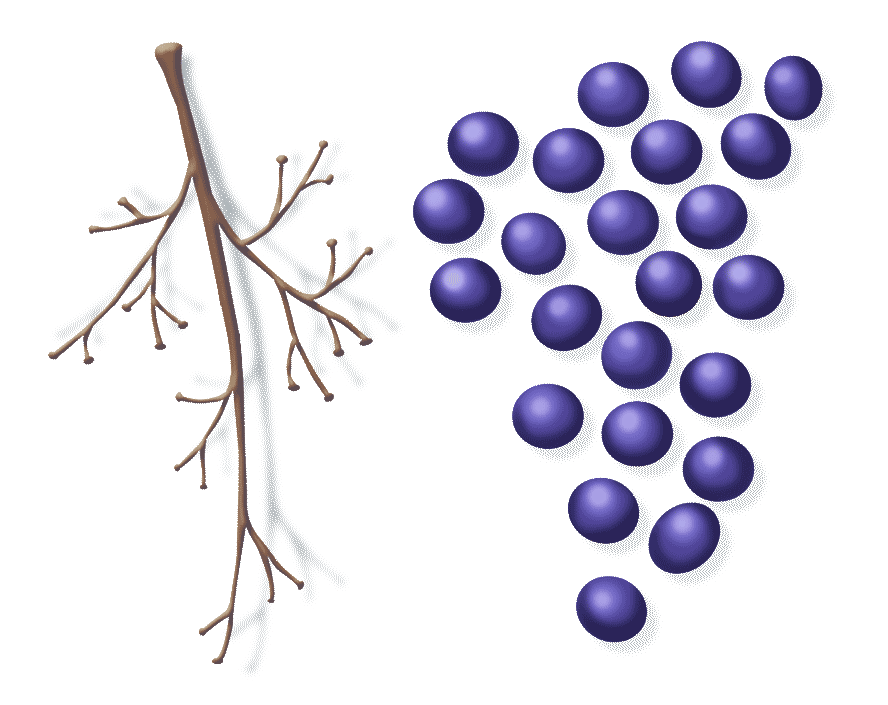
der Nahrungsmittel und verkürzen die der Verbraucher"
(Oliver Hassencamp)
Sicher ist dieser Satz etwas polemisch, beschreibt er doch überspitzt
die Wirkung chemischer Zusätze. Unbestritten ist jedoch die Tatsache,
daß chemische Konservierungsstoffe die Produktion von Lebensmitteln
einfacher und kostengünstiger machen sowie die Haltbarkeit verlängern.
Andererseits lehnen viele Verbraucher chemische Konservierungsmittel ab.
Allergiker reagieren schon auf kleinste Mengen allergener Stoffe.
Wie hoch darf die gesundheitlich noch unbedenkliche Schwefeldosis pro Tag sein?
Eine Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation -WHO- legte die duldbare tägliche
Aufnahme, den ADI-Wert bei Schwefel fest.
ADI-Wert: 0 - 0,7mg je kg Körpergewicht
Ein Erwachsener mit 70 kg Gewicht sollte demnach täglich höchstens 49mg Schwefel aufnehmen.
Für Allergiker gelten noch niedrigere Werte, sicher nahe null. Diese Tatsachen veranlassten den
Gesetzgeber zum Handeln. Alle Weine in der EU tragen den Pflichthinweis "Enthält Sulfite",
wenn der Gehalt über 10 mg/L liegt. Zum Schutz der Verbraucher gilt diese Vorschrift in den USA
und Japan schon seit vielen Jahren.
10 mg/L werden toleriert, da Traubenmoste schon einige mg Schwefel enthalten, zusätzlich
wandeln Hefen das mosteigene Sulfat zu Sulfit um. Dabei entstehen oft sogar mehr als 10 mg.
© 2000 Österreichischer Agrarverlag, Leopoldsdorf
Warum überhaupt SO2 -Einsatz?
Die Methode des Schwefeleinschlags bei Holzfässern war schon den Griechen und
Römern bekannt, bei uns wurde die Schwefelung im späten Mittelalter eingeführt.
Im 15. Jahrhundert gab es die ersten Bestimmungen zur Begrenzung der Einsatzmengen.
Wenn auch SO2 ein toxisches Reagenz ist, so wird sein Ruf als eines der wichtigsten
Weinbehandlungsmittel durch seine vielen, voneinander unabhängigen Wirkungen begründet.
1. Biologische Wirkung
Hemmung von wilden Hefen und Bakterien (Essig, Säureabbau),
die sehr empfindlich reagieren. Dadurch ergibt sich ein Selektions-
vorteil und größere Sicherheit bei Gärung und Säureabbau.
2. Reduzierende Wirkung
Sauerstoff wird abgebunden, Weininhaltsstoffe werden vor Oxidation
geschützt, bereits Oxidiertes kann wieder reduziert werden.
3. Enzymaktivierende Wirkung
Sauerstoffübertragende Enzyme werden gehemmt, Farbschädigungen
dadurch verhindert.
4. Geschmacksverbessernde Wirkung
Abbindung von Nebenprodukten (Carbonnylverbindungen wie Acetaldehyd, Pyruvat, etc.)